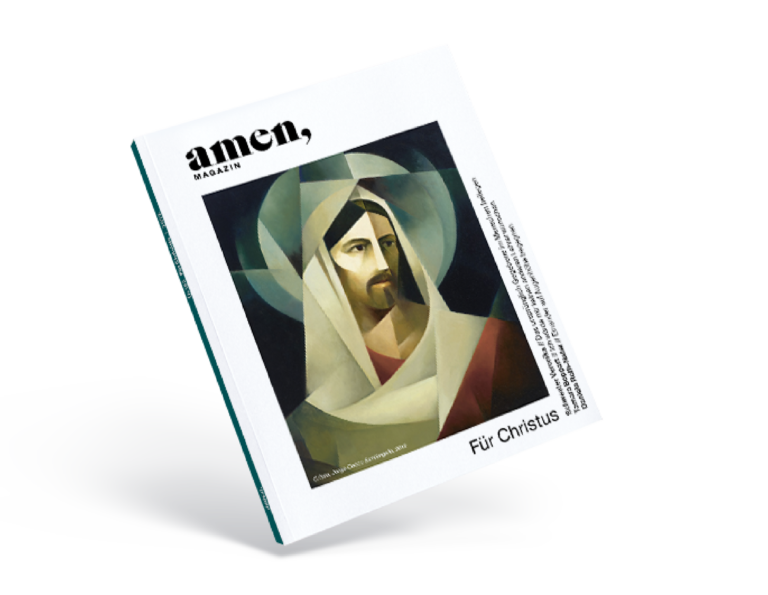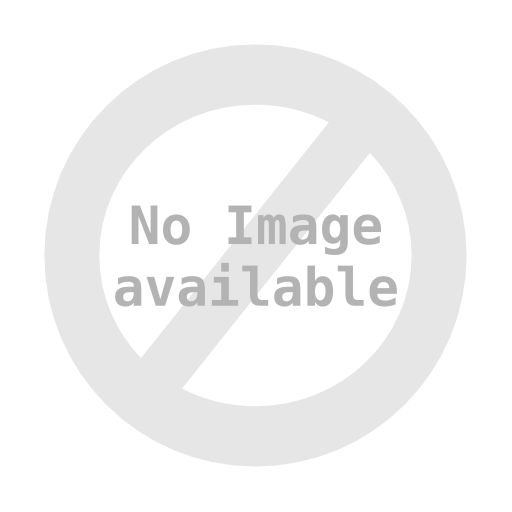Und siehe da: Es wurden alle satt
| von |
Manuela Fassbind |
Für die Betriebsökonomin und Stadtparlamentarierin Daniela Roth-Nater ist «Leben teilen» kein frommes Klischee, sondern radikaler Alltag – ein Geben und Nehmen auf allen Ebenen. Dabei sei nicht das Ziel, dass wir alle gleich werden, sondern uns auf Augenhöhe begegnen und alle unseren Teil zu einem besseren grossen Ganzen beitragen.

Daniela, welche Eigenschaft von Christus hat deinem Leben am stärksten Richtung verliehen?
Es ist die Art, wie er mit seinen Mitmenschen unterwegs war. Er sagt: Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? (1. Johannes 4,20) Er selbst hat uns das wunderbar vorgemacht. Und da waren so richtig schräge Vögel um ihn herum. Menschen mit starken, teils ausgefallenen Charakteren. Aber sie waren zusammen unterwegs, haben sich aneinander geschliffen und gegenseitiges Unverständnis war kein Grund zur Trennung, sondern eine Chance für Wachstum. Sie haben das Leben geteilt – ich denke, dafür sind wir Christen und Christinnen gedacht.
Du bist selbst in einem offenen Haus aufgewachsen. Wie hast du «Leben teilen» gelernt?
In Gemeinschaft mit verschiedenen Menschen zu leben, war immer Teil meines Alltags. Ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen. Meine Grossmutter mit Alzheimer, Lernende, Menschen aus dem therapeutischen Wohnen, mit dem meine Eltern zusammenarbeiteten, Frauen mit Essstörungen, Männer aus der Drogenreha oder Jugendliche in einem Timeout gingen bei uns ein und aus. Es war immer klar, dass es verschiedene Menschen gibt und alle selbstverständlich dazugehören. Auch diejenigen am Rande der Gesellschaft, die ihr Zuhause verloren oder verspielt haben. Wir hatten immer eine offene Türe. Auch als ich heiratete und wegzog, lebten wir als Ehepaar weiter in diesem Stil. Ich habe aufgehört zu zählen, mit wie vielen Menschen ich bereits zusammengelebt habe: diverse Familien, Kinder, ein Au-pair, ein Mann mit starkem Asperger, ein mittelloser Opernsänger und seine kranke Frau im neunten Monat schwanger. Wir sind nicht alle gleich, aber wir sitzen alle im selben Boot. Aus dieser Überzeugung leiteten wir über die letzten Jahre ein gemeinschaftliches Wohnen in Winterthur.
Was hat dich immer wieder motiviert, dranzubleiben?
Ich fühle mich extrem beschenkt von Menschen, die schon mit mir zusammengewohnt und ihr Leben mit mir geteilt haben, auch wenn es nicht immer einfach war. Darin habe ich auch persönlich immer wieder Gnade erfahren. So durften wir beispielsweise viel Solidarität erleben, als mein Mann kurz nach dem Beginn des Lockdowns an den Folgen eines Herzinfarktes unerwartet gestorben war. Meine vier Kinder und ich schienen verloren und doch waren wir es nicht, denn mit den Menschen in unserer Hausgemeinschaft erlebten wir in dieser Zeit die tragende Nähe Gottes ganz besonders.
Ausgewählt, wer mit uns zusammenlebt, haben wir nie. Gott hat uns die Menschen über den Weg geschickt und wenn man sich an gewisse Regeln gehalten hat, konnte ein Zusammenleben entstehen, das für niemanden eine Überforderung war – auch wenn man noch so unterschiedlich ist.
Wie hältst du diese Unterschiedlichkeit aus?
Um miteinander zu leben, müssen wir uns durch Christus sehen. Wir dürfen zum Kreuz schauen und jeden Tag alle zwischenmenschlichen Konflikte, unsere kulturelle Prägung oder unsere theologischen Sichtweisen beim Kreuz ablegen. Durch die Vergebung von Jesus können wir uns nahe sein, auch wenn wir nicht gleich sind, denn er hebt alle Ungleichheiten auf. Das Leben ist ein Geben und Nehmen auf Augenhöhe mit Christus im Zentrum. Dabei ist der gegenseitige Respekt enorm wichtig. Durch all die Jahre erlebten wir ein breites Spektrum an menschlichen, spirituellen, politischen und christlichen Couleurs. Um dem zu begegnen, ist es wichtig, dass man miteinander redet, sich mit Fragen und Antworten, Stärken, Schwächen oder Idealen auseinandersetzt und sich darauf einlässt, dass es auch anders sein kann, als ich es bis anhin glaubte oder lebte. Das ermöglicht Begegnungen auf Augenhöhe.
Wie hast du es geschafft, mit anderen auf Augenhöhe zu leben, zumal du die Leiterin des gemeinschaftlichen Wohnens warst, ihr Leute aufgenommen habt und du so in der Hierarchieordnung anderen übergeordnet warst?
Leute aufnehmen ist nicht der richtige Ausdruck: Wir haben mit Menschen zusammengelebt, und in diesem Zusammenleben trägt jeder und jede verschiedene Hüte. Jemand muss ein Ämtli koordinieren, jemand muss es machen und jemand muss es kontrollieren. Das sind verschiedene Aufgaben, die nichts mit Hierarchie zu tun haben. Natürlich muss man sich das immer wieder vor Augen führen und es war meine Aufgabe, diese Kultur in unserem Wohnen entsprechend zu prägen. Ich versuchte immer, aufzuzeigen, wie alle ihren Teil zur Gemeinschaft beitragen können. Für die Frau mit einer Beeinträchtigung waren es unter anderem Finanzen vom Sozialamt, während ein Student Zeit für Gespräche mit ihr hineingab und dafür günstiger wohnen konnte.
Vor allem zeigt sich die Augenhöhe im Teilen von Alltäglichem. So war es uns immer wichtig, dass wir transparent leben. Das Austragen der Dispute innerhalb unserer Familie bekam man mit, jedoch genauso, wie wir Vergebung suchten und diese einander zusprachen. Dieses Teilen des täglichen Lebens zeigte sich auch in ganz konkreten Dingen. So hatten wir beispielsweise Kleber an unserem Briefkasten, auf denen man lesen konnte, was wir alles gratis auszuleihen haben. Oder wenn uns eine Floristin ihre übrig gebliebenen Blumen brachte, machte ich Sträusse und verteilte sie unter den Nachbarn. Manchmal kamen die Blumenvasen mit Guetzli gefüllt zurück – durch das Teilen fängt Segen an, zu fliessen. Es sind die kleinen Handlungen der Nächstenliebe, die das Leben ausmachen.
Und zum Teilen gehört es, seinen individuellen Teil zu geben. Materiell sowie in seinem Tun.
Genau. Und dabei kommt es nicht darauf an, was wir tun, sofern wir das tun, wozu uns Gott berufen hat. Oder wenn man das Wort Berufung nicht mag: das, wohin uns Gottes Geist zieht. Jeder und jede soll tun, was er oder sie gut kann, was ihn oder sie erfüllt und ihm oder ihr Energie gibt. Dann funktioniert es. Ich werde beispielsweise nie in der Stadtmission Orgelmusik spielen, ich habe auch keine Freunde in Südamerika, von denen ich Seidenschlafsäcke importieren kann, um sie in meinem Sportgeschäft, das ich ebenfalls nicht habe, zu einem fairen Preis zu verkaufen. Ich arbeite auch nicht in der Studierendengruppe, noch werde ich Diskussionen in intellektuell interessierten Zusammenkünften organisieren. Mein Teil ist es momentan unter anderem, im Stadtparlament zu sein, mitzudiskutieren und dabei zu bleiben, um irgendwann zu sehen, wie die Bemühungen ihre Wirkung haben. Ich sehe mich als Volksvertreterin, die ihre Ideen einbringt und sich an den Tisch setzt, um zusammen mit anderen nach Lösungen zu suchen. Es braucht uns alle, damit neue, vielleicht unkonventionelle Ideen entstehen, die uns vorwärtsbringen und Menschen, die noch keinen Platz haben, beim Integrieren helfen. Dabei müssen wir alle unsere Verantwortung wahrnehmen, auch wenn sie nur darin besteht, an die Urne zu gehen und abzustimmen. Wir sind alle kleine Rädchen, die unsere Gesellschaft am Laufen halten, und es braucht das Ineinandergreifen dieser Rädchen. Wir müssen nicht alle gleich werden.
Wenn wir nicht alle gleich werden müssen, was ist dann Gerechtigkeit?
Gerechtigkeit fängt dort an, wo ich aufhöre, in Schwarz und Weiss und in Richtig und Falsch zu denken, mein eigenes Herz anschaue und mir vergeben lasse. Dann muss ich mich nicht mehr rächen, sondern werde aus der Spannung, Gerechtigkeit herzustellen, erlöst – im Wissen, dass Gott alles zu seiner Zeit richten wird. Ich muss nichts mehr erreichen und kann entspannt meinen Teil dazu beitragen, dass die Ungerechtigkeit kleiner wird. Das fängt damit an, mir zu nehmen, was ich heute brauche, und nicht das, was ich glaube, morgen zu benötigen. Im Vertrauen darauf, dass Gott für mich sorgt – so wie er den Lilien ein prächtiges Gewand gegeben hat und die Vögel ernten lässt, was sie nicht gesät haben (Matthäus 6) –, brauche ich mir keine Vorräte anzuhäufen.
Wie kann ich der Versuchung, Dinge anzuhäufen, entgegenwirken?
Das ist herausfordernd in einer Multioptionsgesellschaft. Wir haben ständig unendlich viele Optionen vor Augen, welche wir uns offenhalten möchten. Damit sie offen bleiben, arbeiten wir, investieren Geld, setzen Mittel ein, denn man weiss ja nie, was morgen sein wird. Wir häufen Ressourcen für uns an und verschwenden sie somit. Denn wenn ich mir zwei Äpfel nehme, weil ich eventuell morgen nochmals hungrig bin, hat es heute für jemanden keinen.
Wer dem entgegenwirken möchte, soll damit beginnen, sich zu entscheiden. Wenn ich mich auf etwas festlege, brauche ich die Ressourcen für all die anderen Optionen nicht mehr. Wir sollten aufhören zu warten, ob noch etwas Besseres kommt, und beginnen zu leben. Wenn etwas nicht funktioniert, können wir immer noch flexibel korrigieren.
Und es schadet auch nicht, mal Verzicht zu üben und Suffizienz zu leben, indem ich Material und Energie spare – im Bewusstsein, dass die natürlichen Ressourcen begrenzt sind.
Verzicht scheint sich schwer mit einer Gesellschaft zu verbinden, in der Wohlstand und Selbstverwirklichung ein hoher Wert sind.
Doch, das lässt sich vereinen. Wenn ich weiss, dass ich geliebt und okay bin, kann ich sein, wer ich bin, und geniessen, was ich habe. Aber ich muss nicht mehr ständig nach mehr streben und werde nicht von mehr Reichtum, grösserer Macht oder einem idealen «Ich» getrieben, sondern bin erfüllt von dem, was ich bin und habe.
Die vielen Optionen, die wir haben, sind nicht schlecht. Aber wir müssen lernen, uns zu entscheiden, dankbar im Heute zu leben und zufrieden zu sein mit dem, was wir haben, ohne die Perspektive für eine bessere Zukunft zu verlieren. Nur so werden wir die gegebenen Ressourcen sinnvoll nutzen. Wie genau das funktioniert, muss jede und jeder persönlich immer wieder neu herausfinden und für sich die Fragen «Was habe ich?«, «Was brauche ich?» und «Was kann ich geben?» beantworten. So schreiben wir Geschichte, wie es auch bereits die Christinnen und Christen vor zweitausend Jahren gemacht haben. Als Jesus ihnen sagte, sie sollten allen Menschen zu essen geben, und sie ihn fragten, woher sie denn nun Brot für die ganze Menge herhaben sollten, sagte er: «Geht hin und seht nach, wie viel wir haben» (Markus 6,38). Und siehe da: Es wurden alle satt.
Personenbeschreibung
Das Gespräch mit Daniela Roth-Nater hat bei dreissig Grad auf ihrem Balkon der am Tag zuvor bezogenen Wohnung zwischen Zügelkisten stattgefunden. Die gelernte Schreinerin, Betriebsökonomin FM und Religionspädagogin ist dankbar für die beiden Stühle, die ihren Balkon bereits wohnlich machen. Sie hat vier Kinder, wovon drei bereits erwachsen sind, setzt sich unter anderem für Flüchtlinge ein, unterstützt Familien, betreut Gastfamilien und wirkt im Stadtparlament Winterthur mit. Bis vor kurzem leitete sie das begleitete Wohnen «Birkengarten» in Winterthur. Sie freut sich darauf, zu sehen, wie Veränderung in der Stadt passiert, wie Menschen aufblühen und wann zu ihren Stühlen noch ein Tisch dazukommt.
 Bild
Bild